KI ist nicht die Lösung für alte Probleme – sondern der Anstoß für neue Fragen
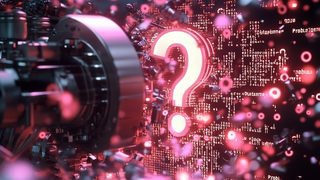
KI ist nicht die Lösung für alte Probleme – sondern der Anstoß für neue Fragen
Die Zahl der Konferenzen rund um Künstliche Intelligenz wächst stetig. Vertreter:innen aus Wirtschaft, Verwaltung und Technologie diskutieren über digitale Zukünfte, den strategischen Einsatz von KI und die tiefgreifenden Transformationsprozesse in Organisationen. Der gemeinsame Tenor: Der digitale Wandel muss schneller und entschlossener vorangetrieben werden – sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor.
Der Druck steigt. Komplexere Verwaltungsaufgaben, wachsender Effizienzdruck, zunehmende Cyberbedrohungen und der Bedarf an zukunftsfähiger Infrastruktur lassen wenig Spielraum für Stillstand. Dabei stehen die technologischen Lösungen längst bereit: Chatbots in der Bürgerkommunikation, automatisierte Verwaltungsprozesse, smarte Assistenzsysteme wie „Co-Pilots“ oder datengestützte Entscheidungen im Unternehmenskontext.
Auch in der Wirtschaft geht es um nichts Geringeres als den Erhalt von Wettbewerbsfähigkeit – insbesondere im Hochlohnland Deutschland. Vom digitalen Onboarding in HR-Abteilungen bis hin zu sicheren Cloud-Lösungen zur Verwaltung komplexer Datenströme: KI-Anwendungen sind heute breit einsetzbar und entwickeln sich rasant weiter.
KI auf dem Vormarsch
Die Zahlen sprechen für sich. Laut dem ifo Institut (2024) setzen mittlerweile 27 % der deutschen Unternehmen KI ein – eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr (13,3 %). Besonders stark vertreten ist KI im verarbeitenden Gewerbe: Dort liegt der Anteil bei 31 %, in Branchen wie der Automobil-, Elektronik-, Pharma- und Textilindustrie sogar bei über 33 %. Bei Dienstleistern sieht es noch eindrucksvoller aus: In der Werbe- und Marktforschungsbranche liegt der Anteil bei 72 %, bei IT-Dienstleistern bei rund 60 %.
Auch die Unternehmensgröße beeinflusst den Einsatz von KI deutlich:
- In Großunternehmen (250+ Mitarbeitende) liegt der Anteil bei 48 %,
- in mittleren Unternehmen (50–249 MA) bei 28 %,
- in kleinen Unternehmen (10–49 MA) bei immerhin 17 % (Statista, 2024).
Gleichzeitig steigt auch das Angebot an Weiterbildungen und Trainings rasant. Plattformen wie der KI-Campus, das Mittelstand-Digital Zentrum oder das Hasso-Plattner-Institut bieten Programme, die sowohl technisches Know-how als auch das nötige Mindset für den sinnvollen Einsatz von KI vermitteln.
Viel Wissen – aber noch wenig Transformation
Zahlreiche Whitepaper und Leitfäden geben Hilfestellung, wie sich KI in Organisationen einsetzen lässt. Eines davon ist „Führung und Künstliche Intelligenz – ein Leitfaden“ (Möslein et al., 2020). Es analysiert die Herausforderungen und Potenziale im Zusammenspiel von KI und Leadership und richtet sich mit konkreten Empfehlungen an Führungskräfte.
Doch hier beginnt die eigentliche Debatte: Viele dieser Leitfäden bleiben auf einer operativen oder rein technologischen Ebene stehen. Sie bieten Werkzeuge – aber keine Vision. Aus meiner Sicht braucht es mehr: einen grundsätzlichen Diskurs über die strategische, ethische und kulturelle Einbettung von KI. Denn KI verändert nicht nur Tools – sie verändert unser Denken, unser Entscheiden, unser Führen.
Führung vor einem Paradigmenwechsel
Im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz müssen wir Leadership neu denken. Führung bedeutet künftig nicht mehr nur, Menschen zu führen – sondern auch Datenflüsse, automatisierte Entscheidungsprozesse und algorithmische Systeme zu orchestrieren. Es reicht nicht, agile Methoden einzuführen oder KI punktuell zu integrieren. Gefordert ist ein neues Verständnis von Organisationsarchitektur, das Technik, Verantwortung, Teilhabe und Weitsicht miteinander verbindet.
Ein besonders kritischer Punkt: Was passiert, wenn KI-Systeme nicht mehr nur Vorschläge liefern, sondern Entscheidungen strukturieren – und Menschen ihnen lediglich zustimmen?
Die Grenze zwischen aktiver und passiver Entscheidung verschwimmt. Wenn unsere Einschätzungen durch KI-generierte Daten bestätigt werden, verändert das die Legitimation und die Qualität von Entscheidungen.
Deshalb brauchen wir neue Entscheidungsräume – mit klaren Herleitungen, mit Rückverfolgbarkeit und mit einem Bewusstsein dafür, wann eine Entscheidung wirklich vom Menschen getroffen wurde – und wann von einem System.
Was wird künftig (nicht mehr) entschieden?
Eine weitere spannende Frage: Worüber müssen wir in Zukunft eigentlich noch selbst entscheiden?
Welche Aufgaben werden automatisiert? Welche neuen entstehen? Klassische Führungsrollen – ob Teamleitung, Projektleitung oder C-Level – beruhen auf der Vorstellung, Organisationen seien steuerbar. Führung bedeutete: Wissen haben, entscheiden, koordinieren, motivieren, Sinn stiften, priorisieren.
Doch viele dieser Aufgaben können von KI übernommen werden. Datenbasierte Systeme erkennen Zusammenhänge oft schneller, umfassender und objektiver als Einzelpersonen. Sie treffen Entscheidungen konsistenter und effizienter.
Daraus ergibt sich eine neue Grundsatzfrage: Wer übernimmt Verantwortung für KI-gestützte Entscheidungen?
Könnte ein dezentrales System – etwa basierend auf Blockchain-Technologie – Verantwortung kollektiv, ethisch und nachvollziehbar abbilden? Vielleicht ist das noch Zukunftsmusik. Vielleicht aber auch ein realistisches Modell für die nächsten Jahre.
Hybride Führung als Zukunftsmodell
Im Hier und Jetzt bleibt die Verantwortung bei den Führungskräften. Ihre Aufgabe verändert sich: KI-Systeme müssen nicht nur eingeführt, sondern auch aktiv gestaltet, evaluiert und bei Bedarf ersetzt werden. Führung bedeutet mehr denn je: mitdenken, eingreifen, reflektieren.
Hybride Führung wird zum Schlüsselbegriff. Denn auch in datengetriebenen Organisationen brauchen Menschen Orientierung – und einen Gegenpol zur algorithmischen Rationalität. Emotionale Intelligenz, Empathie und Kommunikationsfähigkeit werden zu zentralen Führungsqualitäten.
Gleichzeitig braucht es neue Standards:
- Governance-Strukturen,
- ethische Prinzipien
- und Transparenz in Entscheidungsprozessen.
Denn nur wenn Führung diese Grundpfeiler berücksichtigt, kann KI ihr Potenzial entfalten – nicht als Lösung alter Probleme, sondern als Impulsgeberin für neue, bessere Fragen.
